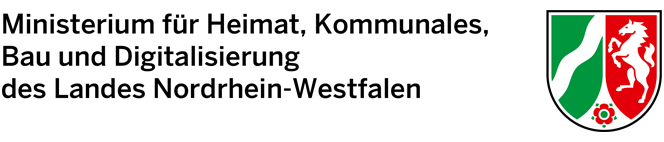Einblicke aus der Praxis bei der Stadt Düsseldorf
Um die BIM-Ziele für den Betrieb aus Sicht der LHD zu erfassen und zu definieren, haben wir zunächst eine BIM-Strategie für den Gebäudebetrieb mit folgenden Zielstellungen formuliert:
- Alle Informationen sind aktuell und zentral in dem digitalen Bauwerksinformationsmodell bzw. in verknüpften Datenbanken abgelegt. Dies wird über den Planungsprozess hinaus in den Betrieb überführt, sodass eine konsistente Dokumentation aller Daten und Informationen entsteht.
- Der Zugriff auf das digitale Gebäudemodell ist für alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leicht möglich. Das visuelle Verständnis gepaart mit der zentralen Datenhaltung schafft eine schnellere Erfassung der Vorort Situation. Sanierungen können so aus der Ferne geplant und zielgerichtet angegangen werden.
- Es existiert eine einheitliche und standardisierte Datengrundlage, die verbesserte Auswertungen ermöglicht.
- Es wird eine zentrale und transparente Aufgabenkoordination anhand des digitalen Gebäudemodells geschaffen. Die Kommunikationswege werden verschlankt und effektiver genutzt.
- Durch die modellbasierte und standardisierte Arbeitsweise werden Workflows und Arbeitsabläufe optimiert und vereinfacht.
- Die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern, mit externen Partnerinnen und Partnern sowie die Öffentlichkeitsarbeit werden verbessert und Arbeitsaufwände perspektivisch reduziert.
- BIM soll eine Plattform für zukünftige Entwicklungen darstellen, sodass neue Tools einfach in die Softwarelandschaft integriert werden können.
- Durch zukunftsweisende Prozesse und die Verwendung digitaler Tools wird die Stadt eine attraktive Arbeitgeberin.
Ergänzend wurden folgende beabsichtigte Mehrwerte bei der strategischen Ausrichtung auf BIM im Betrieb definiert:
- Der Erfassungsaufwand von Gebäudeinformationen wird auf Seite des Betriebs verringert, da Informationen aus dem Planungsprozess bereits als Grundlage für den Betrieb genutzt werden können.
- Es werden bidirektionale Verknüpfungen geschaffen, sodass innerhalb der IT-Infrastruktur Dateninformationen unterschiedlichen Formats integriert und ausgetauscht werden können.
- Während der Erstellung der Anwendungsfälle werden städtische Betriebsprozesse analysiert, hinterfragt und optimiert.
- Der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherungspflicht kann besser nachgekommen werden.
Bisher ist die aktive Verwendung von Bauwerksinformationsmodellen im Betrieb noch auf einer strategischen Ebene. Für unsere laufenden Pilotprojekte haben wird jedoch bereits Informationsanforderungen mitgedacht und die ersten Bauwerksinformationsmodelle mit Betriebsdaten liegen bereits final vor. Derzeit beschäftigen wir uns mit der Anbindung unseres CAFM Systems an den BIM Prozess. An diesem Punkt werden wir perspektivisch umfängliche Umstellungen unserer IT-Landschaft vornehmen. Es ist aktuell noch schwer, für die gesamte Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf zu sprechen. Wir fokussieren in der Betriebsstrategie zunächst den Hochbau. Es wird jedoch auch in weiteren Ämtern bereits definiert, welche Informationsanforderungen zu Bauwerken für den Betrieb notwendig sind.
Zunächst ist die Stadtverwaltung bei zunehmenden Fragen zur Digitalisierung auch mit dem Thema BIM in Berührung gekommen. Dadurch ist das Bewusstsein gewachsen, dass diese Methode für eine zukunftsorientierte Verwaltung von Bedeutung ist. Darauf aufbauend wurde ein BIM Strategiepapier für die LHD erstellt. Zur Umsetzung dieser Strategie wurde im ersten Schritt eine BIM-Geschäftsstelle eingerichtet, die den Aus- tausch zwischen den an der Implementierung beteiligten Ämtern koordiniert. Außerdem betreut diese Geschäftsstelle diverse Arbeitsgruppen und -kreise, die gesamtstädtische Standards entwickeln wollen. Unabhängig davon werden in den einzelnen Ämtern Pilot- und Implementierungsprojekte zum Erfahrungsgewinn vorangetrieben. Unter Pilotprojekten verstehen wir konkrete Baumaßnahmen, bei denen Aspekte der BIM-Methodik durch praktische Anwendung auf ihre Tauglichkeit im alltäglichen Projektgeschäft geprüft werden. In Implementierungsprojekten werden bestehende, interne Arbeitsabläufe untersucht und geprüft, welche durch die BIM-Methode unterstützt und verbessert werden können. Zur Strukturierung dieser Vorgehensweise hat das Gebäudemanagement eine interne Betriebsstrategie aufgesetzt. Sehr wichtig waren für uns hier umfassende Workshops, um das Mind-Set bei den Beteiligten zu schaffen. Um im Projekt generierte Daten auch im Betrieb nutzen zu können, werden in Pilotprojekten ab Projektbeginn Informationsanforderungen entwickelt und fortgeschrieben. Aus dem Bestreben, immer auf dem aktuellen Stand zu sein, beteiligt sich die Stadtverwaltung am interkommunalen Austausch zu BIM und nimmt aktiv an mehreren Forschungsprojekten teil.
Zu Beginn wurde die BIM-Thematik von den bauenden Ämtern und dem Katasteramt angestoßen. Durch den Zusammenschluss der Vertreterinnen und Vertreter
zu einem Netzwerk wurden weitere Akteurinnen und Akteure, wie z. B. das Hauptamt involviert. Die Hauptarbeit liegt dabei weiterhin in den einzelnen Ämtern. Die Beteiligung der einzelnen Bereiche innerhalb der Ämter ist heterogen. Im Gebäudemanagement befassen sich beispielsweise die Stabsstelle für Projekte, sowie das technische und das kaufmännische Gebäudemanagement mit BIM und werden von organisatorischen Abteilungen wie etwa der IT unterstützt. Angestoßen wurde dies durch die Stabsstelle für Projekte. Es bestand dort der Wunsch, die Planungsmethode in Projekten umzusetzen.
Herausforderungen bestehen in jedem Fall. Im Wesentlichen betreffen diese die Bereiche Kapazität, Finanzierung, Organisation und Technik. Zunächst zu dem Bereich der Kapazität: Die Arbeit der Implementierung wird bisher auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt, die ohnehin in ihrem Hauptgeschäft gebunden sind. Einzelne Ämter konnten in der Vergangenheit bereits neue Stellen zur BIM-Implementierung schaffen und auch besetzen. Dies erfordert Zeit und auch die Stellenschaffung ist aufwendig. Daher haben wir Bereiche, in denen die neuen Stellen noch nicht freigegeben oder besetzt sind. Darüber hinaus bringen neue Beschäftigte, die BIM in Vollzeit anwenden, mehr Geschwindigkeit und Agilität in den Einführungsprozess. Das führt dazu, dass mehr Zuarbeit durch die weiteren Bereiche, beispielsweise aus der IT, erforderlich wird.
Die Schaffung neuer Stellen, Ausstattungen und externer Beratung hat finanzielle Auswirkungen, die rechtzeitig einkalkuliert werden müssen.
Aus organisatorischer Sicht sind bei einer gesamtstädtischen BIM-Einführung die notwendige Transparenz und die Berücksichtigung sämtlicher Interessen wichtig. Daher haben wir definierte Kommunikationswege und Arbeitskreise eingeführt. Diese strukturieren den Austausch. Die Entscheidungsfindungen bleiben jedoch schwierig, weil das Verständnis und die Fachkenntnisse der Methode BIM erst vorhanden sein müssen. Wir arbeiten daher daran, durch Schulungen und Workshops ein einheitliches Verständnis der BIM-Methode bei allen Beteiligten zu erreichen und Entscheidungsfindungen entsprechend zu vereinfachen.
EDV-Lösungen, die die Anwendung der Methode bei der Stadt unterstützen sollen, übersteigen in ihren Anforderungen immer häufiger unsere derzeitige Ausstattung. Zu definieren, welche Möglichkeiten die Neuanschaffungen bietet, ist dabei eine zusätzliche Herausforderung. Einige Anwendungsfälle wie etwa für den Betrieb, bestehen konzeptionell, können aber bisher noch nicht umgesetzt werden. Besonders der bidirektionale Austausch von Informationen aus dem Betrieb wirft für uns Fragen auf, auf die der Markt aus unserer Sicht bislang keine technische Antwort hat.
Wir arbeiten an der Beschaffung und Einbindung einer CDE, die ämterübergreifend verwendet wird, sowie der Umstellung des bestehenden CAFM-Systems. Perspektivisch soll die IT-Landschaft weiter harmonisiert und auf weniger Einzellösungen zurückgegriffen werden. Ebenfalls begrüßen wir die in Entwicklung befindliche Merkmaldatenbank, in der alle Kommunen aus Nordrhein-Westfalen ihre Informationsanforderungen erfassen und untereinander teilen können. Außerdem möchten wird den Austausch mit den anderen Kommunen aufrechterhalten und verstärken. Dies hilft allen Beteiligten. An dieser Stelle ist der Wissenszirkel öffentliche Hand – Digitalisierung und BIM ein gutes und weiter auszubauendes Netzwerk.