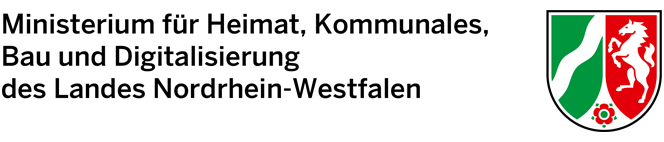Investitionsentscheidungen für ein Bauprojekt werden – insbesondere bei öffentlichen Bauvorhaben – von der Höhe der Herstellungskosten bestimmt. Doch es sind die Gebäudenutzungskosten, die, über die Lebensdauer eines Gebäudes hinweg, bis zu 70 % der Gesamtkosten ausmachen – und bis zu 75 % der CO2-Emissionen verursachen. Diese Kosten belasten die kommunalen Haushalte viele Jahre.
Eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudelebenszyklus ist daher notwendig – finanziell und ökologisch.
Mit BIM lassen sich Gebäudebetrieb, -nutzung und -instandhaltung bereits in der frühen Planungsphase mitdenken. Analoge Prozesse und Medienbrüche entfallen, die relevanten Daten werden digital übertragen. Das reduziert die Kosten und erhöht die Energieeffizienz.
BIM bietet die Möglichkeit, Informationen zu Bauwerken digital zu erfassen und sie in die Prozesse des Gebäudebetriebs zu integrieren.
Zunächst definiert die Kommune die Ziele und Rahmenbedingungen – z. B. zur IT-Infrastruktur – in einer BIM-Strategie. Darauf aufbauend werden projektspezifische Anforderungen (AIA) so konkret wie möglich formuliert: Welche Informationen werden im Betrieb benötigt? Welche Detailtiefe ist notwendig? Bestehende Klassifikationssystem wie CAFM-Connect, DIN 18960 oder VDI 3805 können dabei helfen.
In dieser Phase erfolgt die Informationsmodellierung der Bauwerksinformationsmodelle durch die BIM-Autorinnen und -Autoren. Es entstehen sogenannte Projektinformationsmodelle (PIM), die die Inhalte von Planung und Bauausführung umfassen. Für den Gebäudebetrieb werden gesonderte Bauwerkinformationsmodelle erstellt, mit den in diesem Zusammenhang spezifischen und relevanten Daten. Sie werden als Asset-Informationsmodelle (AIM) bezeichnet.
Diese werden zentral in einer Projekt- oder Verwaltungsdatenumgebung gespeichert und verwaltet – zum Beispiel auf kommunalen Servern oder spezialisierten Plattformen.
Die AIMs werden für ihre Verwendung im Betrieb über digitale Schnittstellen in Systeme des Gebäudemanagements importiert. Um einen möglichst verlustfreien Datenaustausch zwischen dem Bauwerksinformationsmodell und den Softwareanwendungen im Gebäudebetrieb zu ermöglichen, sollte das Modell den Daten- und Schnittstellenanforderungen der genutzten Software-Anwendung entsprechen. Viele Herstellerinnen und Hersteller bieten bereits die Möglichkeit zum Datenaustausch gemäß dem offenen IFC-Standard an. Welche Informationen im Modell oder in der Betriebssoftware gepflegt werden, sollte in der Strategie festgelegt sein.